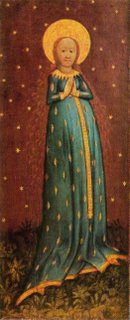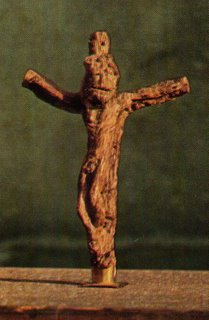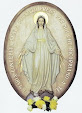Dem "Heiligen Brünndl", das jetzt hinter dem Hochaltar der Wallfahrtskirche fließt, verdankt Maria-Schutz seine Entstehung. Früher stand neben dem Brünnlein ein Bildstock mit einem Marienbild. Durch das Wasser des Brünnleins haben viele in Krankheit und Not Gesundheit und Hilfe erlangt.
Dem "Heiligen Brünndl", das jetzt hinter dem Hochaltar der Wallfahrtskirche fließt, verdankt Maria-Schutz seine Entstehung. Früher stand neben dem Brünnlein ein Bildstock mit einem Marienbild. Durch das Wasser des Brünnleins haben viele in Krankheit und Not Gesundheit und Hilfe erlangt.Im Jahre 1679 wütete in Österreich die Pest. Da wurde mancher am Liebfrauenbrünnderl geheilt. Deshalb gelobten die Bewohner von Schottwien, hier der Mutter Gottes eine Kapelle zu bauen, wenn sie fürder von der Pest verschont würden. Und wirklich wurden, die vom Brünnlein tranken, von der Pest befreit. 1721 wurde mit dem Bau einer kleinen Kapelle begonnen. Während des Baues kam aus Mürzzuschlag ein Franziskaner, P. Eligius. Ermüdet schlief er am Brünnlein ein, und als er erwachte, rief er aus, daß er, wenn er diesen Ort taufen sollte, ihn "Maria-Schutz" nennen würde. Damals erschien auch die Gottesmutter einem kranken, zwanzigjährigen Mädchen aus der Pfarrer Kirchberg, tröstete es und sagte: "Wirst schon wieder gesund werden; kaufe zwei Kerzen und opfere sie in Maria-Schutz!" Damals aber wußte noch niemand, wo Maria-Schutz sei. Im Jahre 1722 erschien Maria noch einmal dem Mädchen und erinnerte es, die Kerzen zu opfern. Eine Kürschnerin in Aspang litt an Wassersucht. Ihr erschien Maria und ermahnte sie zum Vertrauen auf Maria-Schutz. Sie wurde geheilt und kam voll Dank nach Maria-Schutz und rief beim Anblick des Gnadenbildes aus: "O Gnadenmutter, ich habe Dich zwar niemals gesehen; aber wie ich Dich jetzt sehe, so bist Du mir erschienen."
Gar viele Wunder geschahen in Maria-Schutz. In Scharen strömte das Volk zur Gnadenkapelle, die für die vielen Wallfahrer bald zu klein wurde. Auf der Burg Klamm, gegenüber von Maria-Schutz, wohnte damals der Reichsgraf Josef Leopold von Walsegg. Der beschloß, der Mutter Gottes eine größere Kirche zu bauen. 1728 wurde mit dem Bau des heutigen Gotteshauses begonnen. 1737 starb die Gemahlin des Reichsgrafen; er selbst aber wurde nun noch Priester und wirkte in Maria-Schutz. 1739 wurde die Wallfahrtskriche eingeweiht. Später soll auch der hl. Klemens Maria Hofbauer kurze Zeit hier gewirkt haben. 1826 wurde durch einen unbekannten Täter Kirche und Pfarrhaus in Brand gesteckt. Die schönen Zwiebeltürme und die Glocken fielen dem Brande zum Opfer. 1828 ließ die Gräfin von Sternberg die Kirche wiederherstellen. Doch die der Barockkirche eigenen Zwiebeltürme konnten leider bis heute noch nicht wieder aufgebaut werden.
Nach dem ersten Weltkrieg half ein deutscher Passionist einem Wiener Priester in mancher Not. Diesen bat er in einem Brief, den Kardinal Piffl in Wien zu fragen, ob die Passionisten in seine Erzdiözese kommen dürfen. Kardinal Piffl kannte die Passionisten von Rom aus und war mit "Herz und Seele" dafür und übergab schließlich den Passionisten diesen Wallfahrtsort, den er das "Schatzkästlein Niederösterreichs" nannte. Am 1. Oktober 1925 übernahmen die Passionisten Maria Schutz. Bis zum Jahre 1928, da man die 200jährige Grundsteinlegung feierte, war die Kirche vollständig renoviert. Daß Maria-Schutz so herrlich restauriert werden konnte, ist den braven Pilgern zu verdanken, die ihre Scherflein gerne für das Gnadenheiligtum Mariens spendeten.
1945 war Maria Schutz fünf Wochen hindurch dem Beschuß der kämpfenden Truppen ausgesetzt. Zuvor waren die Glocken eingeschmolzen worden. Jetzt wurde das Kircheninnere, das Portal, Dach, Türme und Kloster beschädigt. Aber Gnadenaltar und Gnadenbild blieben unbeschädigt: "Maria-Schutz steht allen Feinden zum Trutz!" Durch die Spenden unserer Wallfahrer sind die Kriegsschäden wieder beseitigt worden.
Die Türme der Wallfahrtskirche sind 45 m hoch, die Kirche ist 36 m lang, 14 m breit und 18 m hoch. Herrliche Barockkunstwerke sind der Hochaltar, die Kanzel und die Orgel. Das Gnadenbild ist wohl über 400 Jahre alt und von unbekannter Hand geschnitzt. Neben ihm stehen Joachim und Anna. Rechts vom Hochaltar ist die Fatimakapelle, die zum Dank für die Errettung aus den Gefahren des zweiten Weltkrieges errichtet wurde und in der Karwoche als Grabkapelle dient. In ihr stehen die Statuen der hl. Theresia vom Kinde Jesu und der hl. Korona. Über der Fatimakapelle ist eine Votivkapelle; die Bilder darin erzählen vom Ursprung von Maria Schutz und von der Hilfe Unserer Lieben Frau. Am Herz-Jesu-Altar sieht man das Bild des hl. Patrizius und die Statuen des hl. Florian und des hl. Eustachius. Neben dem Bild des Kreuzaltares steht die Schmerzensmutter und der hl. Johannes. In der Mitte ist das Bild des hl. Paul vom Kreuz, der 1720 den Orden der Passionisten gründete, die heute 4000 Mitglieder in fast 300 Klöstern und Missionsstationen zählen und deren Aufgabe es ist, das Leiden Jesu zu betrachten und zu verkünden. Am Nepomukaltar, zwischen den Statuen der Apostel Petrus und Paulus, ist das Bild der hl. Gemma Galgani, einer Heiligen des Passionistenordens. Weitere Heilige dieses Ordens sind der hl. Bischof Vinzenz M. Strambi und der hl. Gabriel von der Schmerzensmutter und die Märtyrerin Maria Goretti, die ein heiliges Pfarrkind der Passionisten war. Am Josefsaltar sehen wir noch den hl. Johannes den Täufer und seine Mutter Elisabeth; am Karmelaltar den hl. Angelus und die hl. Theresia von Avila. Das Kloster selbst steht allen offen, die als Brüder oder als Priester bei den Passionisten wirken wollen.